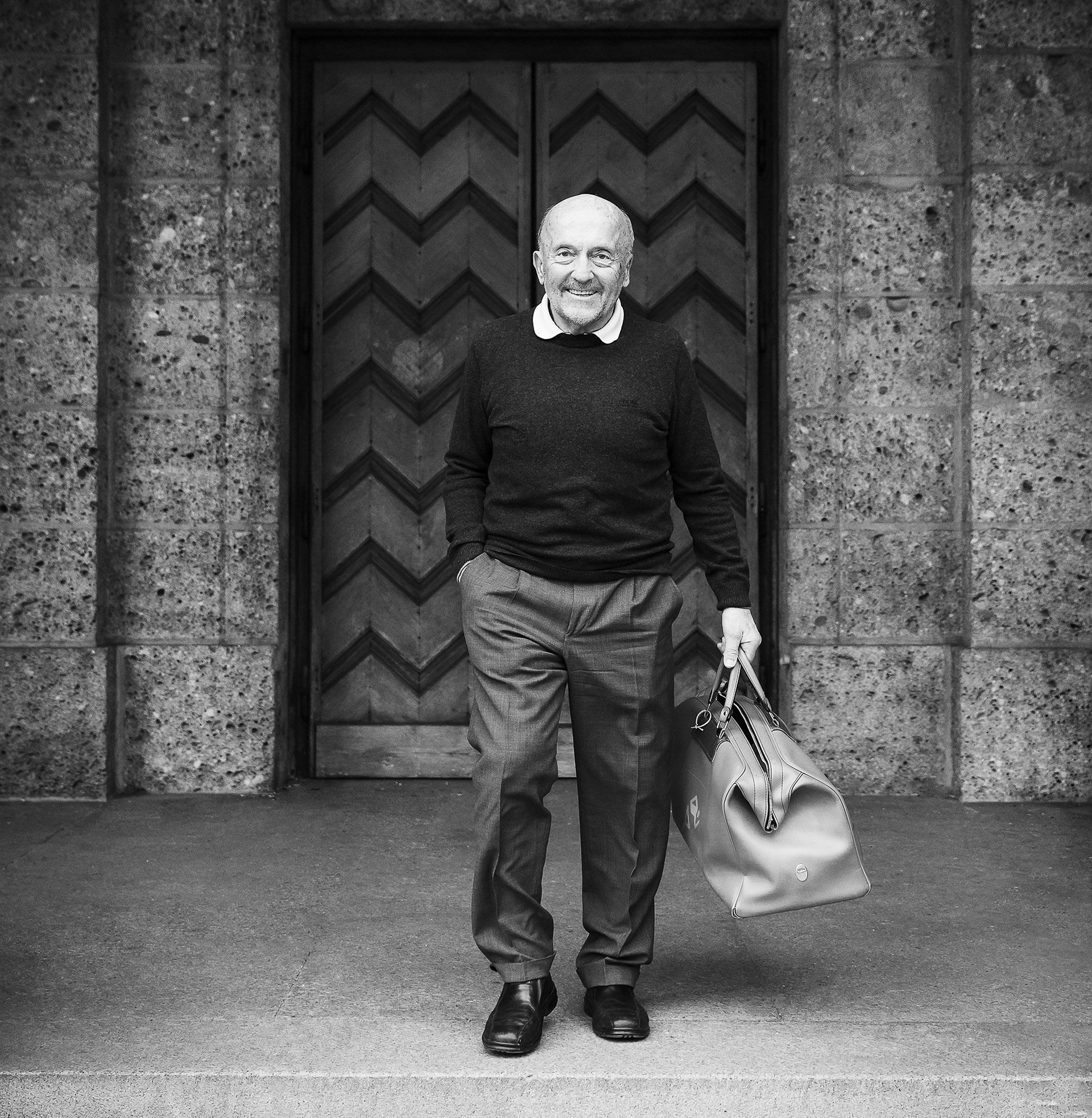
Foto: Magdalena Jooß/TUM.
Das folgende Interview mit Klaus Wolfermann führten wir im Sommer 2018. Am 18. Dezember 2024 ist Klaus Wolfermann im Alter von 78 Jahren verstorben.
Klaus Wolfermann: Mir wurde ganz anders. Urplötzlich war ich nicht mehr einer der Dritten, sondern ich stand ganz oben auf dem Siegertreppchen, die Nationalhymne erklang. Mir rieselte ein Schauer über den Rücken. Selbst heute noch, wenn ich in Schulen oder bei Vorträgen über diesen Moment spreche und Bilder von damals sehe, schüttelt es mich ein bisschen.
Die Faszination für den Sport: Wann hat die bei Ihnen begonnen?
Mein Vater war Schmied und gleichzeitig ein erfolgreicher Turner. Er hat mich immer in die Turnhallen mitgeschleift. So ist bei mir der Funke für den Sport übergesprungen. Von da an war das mein Lebenselixier: Herauszufinden, welche Fähigkeiten mir mitgegeben wurden und wie weit ich gehen kann. Ich habe geturnt, bis ich 14 oder 15 Jahre alt war. Dann kam der Handball dazu. Da hat sich mein kräftiger Wurf schon gezeigt. Und in der Leichtathletik habe ich mich zuerst dem Fünf- und Zehnkampf gewidmet, später dann dem Speerwurf.
Haben Sie sich deshalb nach der Schule an der Bayerischen Sportakademie, die 1972 in die TUM integriert wurde, zum Sportlehrer im freien Beruf ausbilden lassen?
Ich hatte ja zuvor eine Ausbildung als Werkzeugmacher in Nürnberg durchgeführt und bin nebenbei noch zur Schule gegangen, um mich weiterzubilden. Irgendwann habe ich gemerkt: Der Beruf ist zwar gut, aber er würde unter Umständen meinen sportlichen Weg blockieren. Also habe ich mir ein neues Ziel gesetzt: Ich wollte zum Sportlehrer-Studium nach München. Das habe ich 1965 geschafft. Und glücklicherweise hat sich parallel dazu meine sportliche Leistung gesteigert.
Ich bin da durchmarschiert wie ein Verrückter.
Großes Glück und viel Ausdauer. Nach dem Studium habe ich eine Anstellung als Sportlehrer beim SV Gendorf bekommen. Dort konnte ich mich entwickeln. Nicht nur beruflich, sondern vor allem auch sportlich. Ich konnte meinen Beruf und gleichzeitig mein Hobby, den Leistungssport, weiter betreiben. Ich habe viele, viele Stunden in der Woche gearbeitet. Aber ich konnte meine Arbeitszeit so legen, dass ich mein Leistungstraining zweimal pro Tag durchführen konnte: in der Früh zwei Stunden, am Nachmittag zwei oder zweieinhalb Stunden.
Das hört sich anstrengend an.
Das Volumen war heftig. Ich hatte Tage, da war ich 14 Stunden im Betrieb und dann noch das Training. Vor 22 Uhr am Abend war ich nicht zu Hause. Wie ich das ausgehalten habe, ist für mich selbst erstaunlich. Aber das zählt, jetzt kann ich das ja sagen, zu den Feinheiten, die der liebe Gott mir mitgegeben hat: eine Ausdauer, eine wahnsinnige Konsequenz und wenn ich mich wo festgebissen habe wie ein Terrier, dann habe ich das Ding durchgezogen – auf Teufel komm raus.
Mit Erfolg: 1968 haben Sie sich bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften das erste Mal für die Olympischen Spiele in Mexiko qualifiziert.
Ich wurde Deutscher Vizemeister und das berechtigte mich für die Teilnahme in Mexiko. Es war für mich grandios mit so vielen Athleten aus allen Ländern zusammenzukommen, sie beim Training beobachten und dazulernen zu können. Leider bin ich da drüben in der Qualifikation ausgeschieden als Dreizehnter – die ersten 12 kommen weiter.
Mit der Original-Olympiatasche an der TUM: Zum Interview an seiner Alma Mater brachte Olympiasieger Klaus Wolfermann wichtige Erinnerungsstücke mit (Foto: Magdalena Jooß/TUM).
Ich wusste, die nächsten Olympischen Spiele finden in München statt – Hometown, wenn man so will. Da wollte ich ganz vorne mit dabei sein. Das war für mich die Zielsetzung schlechthin. Wir haben also diese vier Jahre bis dahin ganz akribisch geplant. Ich wollte immer direkt in die Höhle der Löwen, zu meinen Gegnern. Also bin ich zu den großen Wettkämpfen gefahren nach Helsinki, Stockholm, Oslo, Riga, dort, wo die großen internationalen Geschehnisse gelaufen sind.
Wie erfolgreich waren Sie bei diesen Wettkämpfen?
Es ist nicht so, dass ich dort gewonnen hätte. Ich wollte mich testen, wollte sehen, wo die anderen ihre Fehler und Schwachpunkte haben und ich meine Stärken. Mir wurde in den Anfangsjahren oft das Fell über die Ohren gezogen, und am liebsten wollte ich wieder nach Hause fliegen. Aber ich wusste, ich muss da durch, nur so kann man lernen und irgendwie findet man den Weg dann für sich selbst.
Das Jahr vor den Olympischen Spielen in München war das Versuchsjahr. Da sah es nicht schlecht aus, ich hatte mich hoch gearbeitet und dreimal in diesem Jahr den deutschen Rekord verbessert, 80, 85 und dann 87 Meter, was damals schon eine Weltklasseleistung bedeutete. Doch der Weltrekord lag bei über 90 Metern! Und dieser Weltrekord ist von einem Mann gehalten worden, der in Mexiko bereits die Goldmedaille gewonnen hatte: Jānis Lūsis, ein Lette. Ich habe mir sehr viel abgeguckt von ihm, in den Vorbereitungsjahren war er mein Vorbild schlechthin. Er hat in diesem Jahr alle Wettkämpfe gewonnen, ein paar Mal den Weltrekord geworfen mit 93,80 Metern, also eine enorme Weite. Für mich eigentlich unerreichbar.
Trotzdem haben Sie es geschafft, ihn zu schlagen. Wie?
Mein Trainer hat mich noch gewarnt, ich soll nicht mehr trainieren, als wir im Trainingsplan vereinbart haben, aber ich war nicht zu bremsen. Das Training hatte einen Riesenumfang, da habe ich mich richtig ausgelebt und immer ein bisschen mehr gemacht. Ich wollte einfach und hatte großen Spaß dabei. Gleichzeitig habe ich ganz intensiv auf meinen Körper gehört: Man kann über eine gewisse Zeitdauer seinen Körper unglaublich steuern. Eineinhalb Wochen vor den Olympischen Spielen gab es einen kleinen Abendwettkampf hier in München. Da habe ich das erste Mal über 90 Meter geworfen.
Das ging dann schon in Richtung Weltrekord.
Ich konnte das erst gar nicht glauben, obwohl ich gemerkt habe, dass ich den Speer gut getroffen habe. Man fühlt das, wenn der da draußen in der Luft hängt, man meint fast, man hätte den ferngesteuert. 90,24 Meter waren das. Danach kam eine Frau mit ihrer Tochter und wollte ein Autogramm. Das war der Hammer, denn ich habe mich verschrieben: Statt 90,24 Meter habe ich 90,48 geschrieben.
Das gibt es nicht: Das ist ja Ihre Olympiaweite.
Unglaublich, was sich alles so ergibt an komischen Zufällen. Aber irgendwie auch ein Omen. Es hat einfach alles gestimmt. Und dann gab es die Sache mit der Uhr.

Der Sprung nach dem Sieg: Bei den Olympischen Spielen 1972 in München bezwang Klaus Wolfermann im Speerwurf den hoch favorisierten Weltrekordler Jānis Lūsis und holte so die Goldmedaille (Bild: privat).
Ich hatte schon vor dem Olympischen Wettkampf ein paar Mal im neuen Olympiastadion in München trainiert und bei den Deutschen Meisterschaften dort gewonnen. Damals wie heute ist es sehr schwer, in diesem Stadion Speer zu werfen, wegen des Kunststoffdaches. Der Wind, der über die Tribüne reinkommt, verursacht Turbulenzen unter dem Dach. Der Speer fliegt nur in einem bestimmten Abflugwinkel. Das hatte ich vorher rausgefunden. Es hat auf der anderen Seite die Anzeigetafel gegeben und direkt darunter eine Uhr. Die war für mich der Fixpunkt. Ich hatte das natürlich auch den anderen Werfern erzählt, nicht nur für mich behalten.
Das heißt, Sie haben auf die Uhr gezielt?
Beim Abwurf anfixiert. In der Stemmphase spannt sich der Körper und darüber baut sich die Energie zum Abwurf auf. Aber die Speerspitze, die muss am Auge bleiben und muss die Richtung aufzeigen, die den späteren Winkel des Abwurfs ergibt. Die Spitze zeigte genau zu dieser Uhr hin. Das war ein Abwurfwinkel von ungefähr 32 Grad, dann ist der Speer lange ausgeflogen.
Und genauso haben Sie es beim Siegwurf gemacht?
Ich war an dem Tag sowas von motiviert, unheimlich konzentriert. Bekannte, die hinterm Abwurf gestanden sind, haben geschrien und gebrüllt, aber ich habe nichts gehört. Nichts. Ich habe die Klappen runter gehabt und bin da durchmarschiert wie ein Verrückter. Bei meinem fünften Versuch habe ich alles auf eine Karte gesetzt, den Anlauf verlängert um ein paar Meter, schneller reingelaufen, Risiko ohne Ende. Hätte auch passieren können, dass ich bei der Abwurfbewegung zusammengebrochen wäre wie ein Kartenhaus. Im Abwurf habe ich schon gespürt, wie der Speer weg ist: voll getroffen. Ich wusste, der ist sehr weit. Die Anzeigetafel hat das dann bestätigt: 90,48 Meter.
Aber Ihr Rivale Jānis Lūsis hatte den Nachwurf.
Da ist das große Bangen und Hoffen und alles miteinander gekommen. Aber es waren zwei Zentimeter weniger bei ihm. Das war für mich zunächst eine Explosion innerlich, eine Freude, ein Halali. Man muss dazu sagen, es kam etwas ganz Wichtiges zum Tragen: Es hat damals das erste Mal die digitale Weitenmessung gegeben. Hätte man, wenn man sich vorstellt, wie vorher, mit dem Maßband gemessen – Maulwurfshügel, Unebenheiten – es wäre vielleicht anders gekommen. Hinterher habe ich mir das Protokoll geben lassen: Es waren genau 2,02 cm. Unglaublich.
Wie war Ihre erste Reaktion auf den Sieg?
Ich war perplex. Ich bin zuerst zu Jānis Lūsis und habe mich dafür entschuldigt, dass ich gewonnen habe. „Das war so nicht geplant“, habe ich gesagt. Man hat gemerkt, dass er enttäuscht war, keine Frage, aber er hat es mit Würde getragen wie ein ganz großer Wettkämpfer. Seitdem sind wir Freunde.
Sind Sie ab diesem Zeitpunkt auf der Straße erkannt worden?
Mensch, logisch! Ich habe erst einmal Urlaub gemacht und als ich nach Hause gekommen bin, war da wäschekörbeweise Autogrammpost. Da muss man sich dran gewöhnen, es ist ein ganz anderes Leben. Es gab Fotos ohne Ende und jeden zweiten Tag ein anderes Interview. Schwierig, denn ich musste ja auch in meinem Beruf weitermachen, die Normalität wiederfinden. Aber Normalität – die hat es nie mehr gegeben.
Sie haben noch weitergemacht als Speerwerfer bei Wettkämpfen, aber dann gab es eine schwerwiegende Verletzung. Wie war das für Sie?
Darf ich das bayerische Wort „beschissen“ sagen?
Sie dürfen.
Ich habe zu viel Ehrgeiz investiert in den Jahren nach 1973. Nach meinem Weltrekordwurf über 94,08 Meter glaubte ich, das ginge immer so weiter. Dabei überschritt ich die Grenzen der Belastbarkeit. Es war eineinhalb Wochen vor den Olympischen Spielen in Montreal. Beim letzten Wettkampf davor in Zürich, ich bin schon qualifiziert gewesen und eingekleidet, spürte ich auf einmal einen großen Schmerz im Ellenbogen. Ein Knochenteil war abgesprengt worden und hatte sich eingeklemmt. Da war ohne Operation nichts mehr zu machen. Ich erlebte die Spiele von Montreal leider vor dem Fernseher. Danach warf ich noch zwei Jahre, aber dann war Schluss.
Ganz Schluss ist bei Ihnen ja nie: Sie sind doch dann noch Bob und Autorennen gefahren.
Ich habe mir vorgenommen, in meinem Leben so viele Sportarten wie nur möglich auszuprobieren, Und wo es mir gefällt, bleibe ich eben etwas länger. Das wird mich immer begleiten, mein Lebensthema. Ich will austesten, wie weit ich es mit den Fähigkeiten bringen kann, die der liebe Gott mir mitgegeben hat.
Ist Ihre Familie auch sportlich?
Meine Frau war Kunst- und Turmspringerin, meine Tochter hat viel Leichtathletik gemacht und ist geritten. Bei der Leichtathletik haben sie meine Tochter immer aufgezogen und gesagt, „Du bist eine Wolfermann und kannst nicht werfen?“. Sie war sehr gut im Laufen und Springen, eine gute Hockeyspielerin, exzellente Skifahrerin. Heute mache ich viel Sport, oft mit meiner Enkelin. Wir haben ein sehr inniges Verhältnis.
Was machen Sie denn zusammen?
Sie geht zum Beispiel mit zum Golf. Da muss ich mich mittlerweile anstrengen, so gut ist sie geworden. Wenn Sie in der Schule zwei Stunden früher Schluss hat, dann ruft sie mich an und sagt: „Opa, hol mich ab, wir fahren noch schnell nach Garmisch rein zum Skifahren.“ Und mittlerweile hilft sie mir sogar bei meinen Veranstaltungen und Tombolas.
Von welchen Tombolas sprechen Sie?
Nach meiner aktiven Sportlerkarriere war ich 13 Jahre lang sehr erfolgreich bei Puma als Promotionsleiter tätig. Danach habe ich eine eigene Agentur gegründet. Wir organisieren bis heute Veranstaltungen, vor allem für die KiO-Kinderhilfe Organtransplantation.
Haben Sie keine Lust auf ein ruhiges Pensionärsleben?
Die Arbeit macht unglaublich Spaß. Ich mache das mit meiner Frau zusammen, und es erhält uns jung. Ich profitiere von einer Gemeinschaft ehemaliger Sportler, die sich sehr engagieren. Bei jeder Veranstaltung habe ich zwischen acht und 15 dieser prominenten Zeitgenossen, die mich unterstützen. Da kann ich nur den Hut ziehen.
Sportler wie der ehemalige Handballprofi Heiner Brand und die Hochspringerin Ulrike Nasse-Meyfahrt kommen, weil Sie sie für die Sache begeistern. Was motiviert Sie dazu?
Im Vordergrund steht für mich, dass wir anderen helfen können, denen es schlechter geht als uns. Wenn man sieht, wie Kinder nach einer erfolgreichen Organtransplantation wieder alles machen können, auch Sport, mit glänzenden Augen, das ist fantastisch. Für diesen Zweck haben wir allein durch unsere Tätigkeit in den letzten Jahren 3,5 Millionen Euro fixiert. Das finde ich eine sehr wertvolle und gute Geschichte. Alle helfen zusammen, eben auch meine Enkelin. Schön, ganz einfach schön. Wenn das so weitergeht, das ist mehr, als ich mir wünschen kann.

Klaus Wolfermann (Bild: Magdalena Jooß/TUM).
Klaus Wolfermann
Sportlehrer im freien Beruf 1968
Klaus Wolfermann absolvierte seine Ausbildung zum Sportlehrer im freien Beruf an der Bayerischen Sportakademie (BSA), die 1972 in die TUM integriert wurde. Sein größter sportlicher Erfolg war der Sieg beim Speerwurf-Wettbewerb der Olympischen Spiele 1972 in München, wo er mit einer Weite von 90,48 Metern den hoch favorisierten Weltrekordler Jānis Lūsis bezwang.
Klaus Wolfermann war sechs Mal nacheinander Deutscher Meister im Speerwurf, zweimal Sportler des Jahres der Bundesrepublik Deutschland und einmal Sportler Europas. Nach dem Karriereende 1978 betätigte sich Wolfermann als Bremser und Anschieber im Bob und wurde im Viererbob des Piloten Georg Heibl 1979 Deutscher Vizemeister und Vierter im Europacup.
Sein Ruhm machte Klaus Wolfermann auch für Sportartikelfirmen interessant: 1980 nahm er eine Stelle als Promotionsleiter bei Puma an und war international tätig. Klaus Wolfermann betrieb eine Sportvermarktungsagentur und engagierte sich als Vorsitzender des FC Olympia, einer Vereinigung von deutschen Medaillengewinnern, die für soziale Zwecke an Fußball-, Volleyball- und Golfspielen sowie sonstigen Veranstaltungen teilnehmen.
Er engagierte sich ehrenamtlich viele Jahre für die KiO-Kinderhilfe Organtransplantation. Klaus Wolfermann war Sonderbotschafter für Special Olympics, der einzigen vom IOC autorisierten Sportgemeinschaft für geistig behinderte Mitmenschen, und Botschafter für die Olympiabewerbung 2018. Seit 1967 war er verheiratet mit seiner Frau Friederike, bekam eine Tochter und eine Enkelin und lebte in Penzberg in Oberbayern.
Am 18. Dezember 2024 ist Klaus Wolfermann im Alter von 78 Jahren gestorben.


